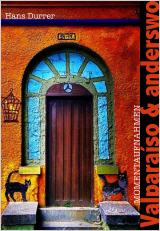» Wie geht das, das Leben?
» Henri und die Buchbesprechung
» Von der Hoffnung, meiner Feindin
» Wie (s)ich mein Leben wieder einmal nicht änderte
» Über Ross Macdonald und Warren Zevon
» Sich der Angst stellen
» Von den Büchern
» Ionesco und ich
Wie geht das, das Leben?
Wie geht das, das Leben?, das war und ist meine Frage. Und die Antwort darauf, die kenne ich: Die richtige Art zu leben ist unspektakulär, ist uneitel; sie ist möglich, wo immer man sich auch aufhalten mag. Weder braucht man sich den Kopf zu scheren, noch in ein Kloster einzutreten. Es gilt nur zu lernen, gut und gerne zu tun, was man eh schon tut. „La Liberté, ce n‘est pas ce qu‘on veut mais de vouloir ce qu‘on fait“, habe ich irgendwann aufnotiert; letzthin dann bin ich auf diese Fassung gestossen: „Glück ist nicht, das zu haben, was man will. Glück ist, das zu lieben, was man hat.“ Und wenn es so ist, und ich bin überzeugt, dass es genau so ist, warum fällt mir das so schwer, warum finde ich das nur so eigenartig unattraktiv? Es war nicht immer so.
In Jugendjahren gab‘s für mich nur Sport, in fast jeder Form. Leichtathletik, Schifahren, Eishockey, doch vor allem Fussball. Auch wenn der Schnee einen Meter hoch lag – und das war in Disentis, wo ich drei Jahre lang die Klosterschule besuchte, ab und zu der Fall – , konnte mich nichts vom Fussballspiel abhalten. Körperlich herausgefordert zu werden und auf der Höhe zu sein, gefiel mir. Und wenn die Muskeln schmerzten, gab‘s kein Klagen, sondern ein Mittel dagegen und das hiess: weitermachen, einfach nur weitermachen, solange die Muskeln weiter bewegen, bis der Schmerz nicht mehr zu spüren war. Die dafür notwendige Disziplin aufzubringen fiel mir leicht, denn was ich tat, tat ich aus freiem Willen und ich tat es gerne.
Ich war ein guter Fussballer, wurde bereits in der zweiten Klasse für die Auswahlmannschaft der Klosterschule aufgestellt, später dann auch für die Ostschweizer Juniorenequipe vorgesehen. Doch der Papa erlaubte mir das Mitspielen in letzterer, ungenügender Schulnoten wegen, nicht. Ein halbes Jahr später – ich war damals 16 – war ich aus der Klosterschule geflogen, spielte keinen Fussball mehr und hatte zu rauchen und zu trinken angefangen; zudem hatte die Sehschärfe meines rechten Augen dramatisch abgenommen, es musste operiert werden.
Fascination is the true and proper mother of discipline“, steht in Michael Murphys Golf in the Kingdom. Die Faszination, die ich für den Fussball gehabt hatte, diese bedingungslose Hingabe, war weg, sie hatte ihr Objekt verloren. Plötzlich war ich ohne Halt, fühlte ich mich ohne Orientierung.
Lange Jahre der Idee nachgehangen, dass damals, als ich mit dem Fussballspielen aufgehört habe, ein Lebensfaden gerissen sei. Und dass es nur darauf ankomme, diesen wieder zu flicken, daran anzuhängen. Als ob das Leben eine innere Linie habe, die von uns erkannt werden könne. Doch was uns im Nachhinein häufig so scheinen mag (nichts, was wir uns nicht zurecht biegen vermöchten), hat meist vor allem mit Wunschdenken zu tun. Ich jedenfalls habe nie mehr auch nur entfernt ähnlich eindeutige, unbedingte Empfindungen gehabt wie als jugendlicher Fussballer.
„Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.“ Dieses Gebet stand bei meiner ersten Arbeitsstelle auf meinem Pult, mein Vorgänger hatte es da hinterlassen. Damals interpretierte ich es als Rechtfertigung konservativer Politik (Nur keine Veränderungen!), später nahm ich es resignativ (Man kann eh nichts machen), noch später, sehr viel später, entdeckte ich darin das Wörtchen ‚Mut‘.
Das Leben ist schwierig. Und schwer. Und mühsam. Akzeptiert man dies, wird das Leben zu einer Herausforderung. Einer faszinierenden. So habe ich das zum ersten Mal in Scott Pecks „The road less travelled“ gelesen. Und dann wiederum Jahre gebraucht, bis ich diese Wahrheit auch an mich heranliess, sie schliesslich, immer für Momente nur, zu begrüssen begann. Und weiterhin gilt: diese Momente länger werden zu lassen. Schwierig? Mühsam? Natürlich. Sonst wär’s ja ohne Reiz.
Das Vorbild dabei: das Kind, das laufen lernt. Aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen und wieder aufstehen. Immer wieder. Und ohne zu klagen. Bis es lernt, aufrecht zu gehen.
Aber eben, der Mensch wird älter und denkt (natürlich, ich spreche von mir, von wem denn sonst?): ein wenig weniger mühsam dürfte es schon sein, auch wenn ich nicht viele, doch immer häufiger, Momente erlebe, in denen ich mit völliger Klarheit weiss, dass alles genauso ist, wie es sein muss.
„The readiness is all“, sagt Horatio.
Henri und die Buchbesprechung
Wie meist übersprang er auch an diesem Morgen die Politik, die Wirtschaft und den Sport; die gängige Prioritätenordnung stellte die Kultur an den Schluss. Auf der ersten Seite fand sich unter dem Titel "Ins Hirn gekrochen, ins Herz gespäht" eine Buchbesprechung mit diesem Vorspann: "Drei Chinesen mit dem Kontrabass: Der in Berlin lebende Schweizer Autor Matthias Zschokke legt mit `Das lose Glück` einen neuen Roman vor."
Henri las selten einmal Schweizer Autoren, interessierte sich auch nur mässig, was über sie gesagt wurde. Ein Bild von Herrn Zschokke war dem Artikel beigefügt. Ein schlanker, attraktiver Mann, der offenbar Wert auf sein Äusseres legte. Weisse, weite Bundfaltenhosen, schön gearbeiteter, einfacher, brauner Gürtel, weisses Hemd mit Polokragen.
Im Ammann Verlag sei der Roman erschienen, stand am Ende des Artikels vermerkt. Henri mochte das Programm dieses Verlages, vor allem aus ästhetischen Gründen. Und manchmal fanden sich unter den schön gestalteten Büchern auch Lese-Perlen.
Der Rezensent besprach Zschokkes Buch in der Art und Weise wie Henri sich vorstellte, dass Bücher besprochen werden müssten: er las, dass der Rezensent Oscar Wilde gelesen und sich Gedanken über Zahnärzte und Postmoderne gemacht hatte. Zschokkes Werk, so war weiter zu erfahren, sei nach "einem altbekannten Muster konstruiert. Das Muster heisst: Drei Chinesen mit dem Kontrabass sitzen auf der Strasse und erzählen sich was."
Henri war ein solches Muster nicht geläufig und auch etwas verwirrt, denn in Zschokkes Buch kamen gar keine Chinesen vor. Auch der Kontrabass fehlte und anstelle der Strasse gab es einen See.
Der Rezensent hatte nicht nur das Buch gelesen, er hatte sich auch über den Autor kundig gemacht. Dabei war ihm aufgefallen, dass "viel Gewese", sowohl von Kritikern als auch vom Autor selbst, darum gemacht worden sei, dass Herr Zschokke seit 1980 in Berlin wohnt. Das missfiel dem Rezensenten. Und um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, liess er die Leser wissen, dass der Herr Zschokke in Bern geboren und in Ins aufgewachsen sei. Wahrlich genug Grund, so möchte man meinen, dass der Mann Wert darauf legt, in Berlin ansässig zu sein.
Der Rezensent mochte diesen Matthias Zschokke nicht. Und deshalb mochte er auch das Buch nicht. Anders war nicht zu erklären, dass er am Schluss seiner Besprechung eine ganz wunderbare, in sich abgeschlossene, Stelle zitierte, `Zerrupfte Hühner, die nicht wissen, dass sie sterben, die ganz und gar damit beschäftigt sind, Hühner zu sein, sich in den Sand zu hocken, wieder aufzustehen, das Gleichgewicht zu halten, pickend über einen Hof schreiten, vogelfrei, im losen Glück.`, und dann forderte: "Von diesen Hühnern hätte man gern mehr erfahren."
So recht eigentlich sollte man nur Bücher von Autoren besprechen, gegen die man nichts hat, dachte Henri. Oder noch besser: die man mag.
_______
Von der Hoffnung, meiner Feindin
Ich habe nur einen Feind: die Hoffnung.
Ständig sagt sie mir, alles werde nicht nur gut, sondern noch besser werden; immerzu treibt sie mich an, nie lässt sie mich sein, wo und wie ich bin.
Was wäre der Mensch ohne Hoffnung? habe ich einmal gelesen. Nicht nur Hemingway hat sich dies gefragt, doch ihm, als Alkoholiker (wenn, was wir über ihn gelesen, der Wahrheit entspricht), war die Hoffnung wohl überlebensnotwendiger als anderen, die vielleicht etwas weniger leiden und deshalb dieser tröstenden Vorstellung, dass alles, in der Zukunft, der fernen, eigentlich immer nur besser werden kann, nicht so stark bedürfen.
Wer in der Gegenwart lebt, bedarf der Hoffnung nicht. Vorausgesetzt natürlich, er (oder sie – die künftig immer mit gemeint werden soll) lebt gerne in dieser Gegenwart. Ein solcher muss nicht vertröstet werden, ein solcher schätzt, was er hat.
***
Der Mensch ist grundsätzlich unzufrieden angelegt, und deswegen ein sehnsüchtiges Wesen. Um mit Wilhelm Busch zu reden: was er hat, das will er nicht, und was er will, das hat er nicht. Und deshalb braucht er die Hoffnung, dass er eines (meist fernen) Tages (vielleicht aber auch erst im Himmel), haben wird, was er jetzt schon will (und dann möglicherweise nicht mehr haben möchte – doch das wäre eine andere Geschichte).
Ständig also hofft der Mensch auf bessere Zeiten. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als warten. Dem Spanisch sprechenden Latino ist das eh dasselbe, für ihn bedeuten sowohl hoffen als auch warten esperar, was uns zum Schluss zwingt, dass wenn der Latino hofft, er zur gleichen Zeit auch wartet, und wenn er wartet, er ganz offenbar sogleich hofft. So richtig unmittelbar eingeleuchtet hat mir das, als ich letzthin auf den Bus wartete und dabei hoffte, dass er auch käme.
Für die Latinos ist also der Fall gelöst: sie haben absolut Null-Chance, jemals in der Gegenwart leben zu können. Und scheinen auch gar kein Problem damit zu haben, man denke nur an ihr andauerndes mañana. Oder meint das vielleicht das Gegenteil? Dass also das Heute das Wichtige und alles andere bis morgen warten könne?
Wir andern aber, die wir so gewiss sind, dass wir im Hier und Jetzt leben sollten (möglichst entspannt natürlich), wir haben ein Problem damit, dass wir, so sehr wir es auch wollen, es einfach nicht können.
Wo ein Wille, da kein Weg, sagt uns dazu der Psychologe von heute, und wir glauben zu ahnen, dass da was dran sein könnte, nur haben wir nicht den leisesten Schimmer, wie wir das jetzt praktisch umsetzen sollten. Im Gegensatz zum Psychologen – der fordert für solche Weisheiten Honorar.
Wir trotten also weiterhin ratlos durch die Gegend, wobei wir von Zeit zu Zeit auf Leute treffen, die behaupten, im Grunde sei alles ganz einfach, man müsse nur in der Gegenwart leben. Es sind dies in der Regel Menschen, die den Anblick in Blüte stehender Blumen unweigerlich mit Begeisterungsschreien kommentieren. Ich gestehe, mir ist ein solches Naturell nicht gegeben, und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich wünschte, mir wäre ein solches mitgegeben worden. Und wenn ich schon beim Gestehen bin: mir ist von den mir bekannten drei Zeitzonen – der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft – die Gegenwart am wenigsten lieb. Nicht dass ich das gut finde, doch es ist so.
In einer Kultur gross geworden, die dem Sollen, dem Müssen, eine Prominenz zuweist, die einen in Null-Komma-Nix die Flucht in den Buddhismus antreten lässt, reagiere ich auf Aufforderungen, die mit „Du musst nur“ anfangen, automatisch mit Verweigerung und fühle mich dann fast augenblicklich auf eine mir nicht so recht erklärliche Art schuldig.
Doch so eine Sollens-Kultur bringt es eben auch mit sich, dass man immer weiss, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und darauf hofft, wenn man denn das Seinige zu tun bereit ist, dass die Dinge eines Tages so sein könnten, wie sie eigentlich sein sollten.
Sisyphus scheint davon nicht sonderlich überzeugt gewesen zu sein. Der konzentrierte sich darauf, den Stein den Hügel hinauf zu rollen. Und tat das und nur das und sonst gar nichts. Camus soll gesagt haben, man müsse sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Obwohl mir der Gedanke sympathisch ist, habe ich mir bisher Fliessbandarbeiter nicht als fröhliche Menschen vorgestellt, aber ich bin ja auch kein anerkannter Philosoph.
Lasst alle Hoffnung fahren! hatte ich ja eigentlich immer als Drohung interpretiert. Wenn dem nun aber gar nicht so wäre, wenn das in Wirklichkeit eine Aufforderung wäre, sich der Realität, also dem, was ist, zu stellen? Und einfach zu tun, was zu tun ist, und sich darüber keine weiteren Gedanken zu machen?
Ich weiss nicht so recht. Es klingt mir doch ein bisserl arg nach „glücklich, wer nicht denkt“, und dazu mag ich mich eigentlich nicht äussern, schon deshalb nicht, weil es, das weiss jeder, eindeutig was für sich hat, doch eben genauso eindeutig ziemlicher Humbug ist. Schliesslich ist einer, der denkt, deswegen nicht schon gleich unglücklich.
Und überhaupt, so sagt man, zeichne das Denken den Menschen doch aus.
***
Es gehe darum, den Wald voller Affen im Kopf zur Ruhe zu bringen, sagt der buddhistische Mönch im Hauptsitz des "World Fellowship of Buddhists" in Bangkok. Wir sollten den Atem beobachten, ihm einfach folgen, konstatieren, was passiere. Wenn Gedanken uns ablenkten, sie weder verscheuchen, noch ihnen nachgeben, sondern sich sagen, aha, ein Gedanke, und dann wieder zum Atem zurückkehren.
Ein Mann (der sei früher Professor in Berkeley gewesen, raunt mir mein Nachbar zu) meldet sich: er habe das schon oft geübt, doch nach zwei, drei Minuten sei er regelmässig weg von seinem Atem und voll in Gedanken.
Der Mönch lacht. Das sei normal. Er solle einfach weiter üben.
Mir geht es so wie diesem Mann: ganz schnell bin ich wieder bei meinen Gedanken (und sie bei mir). Das ist vertrautes Territorium. Und überhaupt finde ich meinen Atem zu beobachten ganz und gar nicht attraktiv.
Wir üben jetzt eine halbe Stunde lang Meditation im Gehen, sagt der Mönch. Stehen Sie gerade, fassen Sie den Punkt am Ende der Halle, wo Sie hinwollen, ins Auge. Und jetzt konzentrieren Sie sich auf Ihre Füsse: wie sie auf den Boden treffen, abrollen, sich heben.
Diesmal geht’s, diesmal spüre ich das Heben, Senken, Auftreffen, Abrollen der Füsse, die Vorwärtsbewegung des Körpers, und ohne dass mich Gedanken sofort wieder wegholen. Diesmal brauche ich nicht zu hoffen, diesmal bin ich ganz einfach – und tue, was ich tue.
_______
Wie (s)ich mein Leben wieder einmal nicht änderte
Mein Leben zu ändern, radikal, definitiv, das wollte ich immer schon. Und obwohl ich die Male, die ich’s versucht hab und gescheitert bin, nicht mehr zählen mag, gebe ich nach wie vor nicht auf, nehme mir immer wieder vor, dass ich ab dann und dann (meist an einem Montag, nie an einem Freitag), alles ganz anders, viel besser und nur noch toll und gut machen werde.
Eines Tages las ich in einem Ratgeber, dass man den Tag, an dem man sein Leben ändern wolle, zu einem speziellen Tag machen müsse. Man solle sich, stand da, immer wieder und immer wieder sagen: heute ist mein Entscheidungstag. Nun ja, dachte ich, schaden kann’s auf jeden Fall nicht und so sagte ich: Heute ist mein Entscheidungstag.
Ich machte mir einen zweiten Kaffee. Und sagte von neuem: heute ist mein Entscheidungstag.
Nichts passierte, weder äusserlich noch innerlich. Ich wusste aus Erfahrung, dass meine Motivation, diesen Tag zum absoluten Wendepunkt in meinem Leben zu machen, von Stund zu Stund abnehmen würde. Ich musste mich also konzentrieren, doch worauf nur?
Einmal hatte mir ein Bekannter gesagt, das Heil liege im Tun. Sofort hatte ich an Workaholics gedacht. Jetzt sage ich mir: sieh doch nicht immer alles so negativ, versuch es halt mal. Okay. Tun also. Aber was?
Warum mir bei Tun immer körperliche Betätigung (und nicht etwa Schreibtischarbeit) in den Sinn kommt, weiss ich nicht genau. Ich vermute, es ist wegen dem Fernsehen. Wird nämlich dort ein Beamter gefilmt, sieht man ihn nie einfach nur die Akten lesen. Immer geht er einen Gang entlang, immer nimmt er etwas aus dem Regal oder blättert in einem Buch. Letzthin habe ich sogar einen gesehen, der die Treppe im Bundeshaus zu Bern, nein, nicht hinauf, hinunter und nach draussen rannte.
Wie wär’s mit Joggen? Bei dem Wetter sicher nicht. Meditieren? Vielleicht etwas zu passiv um als Tun durchzugehen, doch mit irgendwas muss ich schliesslich anfangen. Obwohl, also meditieren, das dauernde Stillsitzen, das liegt mir schon ganz und gar nicht, das ist irgendwie so ziemlich gegen meine Natur.
Jetzt reiss dich zusammen, sagte ich mir, heute ist doch dein Entscheidungstag.
Ich setzte mich hin und konzentrierte mich auf meinen Atem. Ein. Aus. Ein. Aus. Und Ein. Und Aus. Und Ein. Und Aus. Nur den Atem beobachten. So aufmerksam wie möglich. Nichts verändern wollen. Beobachten. Da sein. Wach sein.
Ich fühlte mich eher schläfrig als wach. Schon nach wenigen Minuten drifteten meine Gedanken zu den wichtigen Dingen des Lebens. Sagte doch der letzthin der Schweizer Bundespräsident im Fernsehen, er fahre gerne Tram, weil da niemand Aufhebens um ihn mache. Wusste gar nicht, dass man in die Politik geht, weil man nicht speziell beachtet werden will. Und dann die Calmy-Rey, die Aussenministerin, die müsse jetzt einen Neutralitätsbericht schreiben, hab ich gelesen. Da drauf wartet der Rest der Welt sicher schon ganz atemlos. Na ja, vielleicht doch nicht, aber ihr Kollege Schmid, der wartet garantiert darauf, weil der sich ja so genervt hat, dass die Calmy-Rey die israelischen Angriffe auf den Libanon „unverhältnismässig“ genannt hat und das geht natürlich schlecht mit unserer Neutralität (von der die Calmy-Rey wiederum gesagt hat, es gebe einige, die darunter verstünden, in den vier Landessprachen nichts zu sagen) zusammen, weil so, wie es heisst, die militärische Zusammenarbeit mit Israel verunmöglicht werde. Neutralität ist also, was den Schweizern, die daran verdienen, nützt. Irgendwie hätte man das ja gerne etwas genauer gewusst: was für Geschäfte macht die neutrale Schweiz eigentlich mit der israelischen Armee?
Beim Atem bleiben. Ein. Aus. Ein. Aus. Und Ein. Und Aus. Und Ein. Und Aus. Ich versuchte aus halbgeöffneten Augen auf den Wecker zu gucken. Wo stand er bloss? Ich liess meine Blicke durchs Zimmer schweifen. Erfolglos. Nun ja, die zwanzig Minuten, die ich mir zum Ziel gesetzt hatte, waren bestimmt noch nicht um. Also weiter. Ein Aus. Ein. Aus. Und Ein. Und Aus. Dableiben. Es gibt nichts Wichtigeres als da zu sein. Das habe ich mal bei einer Gruppenmeditation gehört. Leuchtet mir ein. Ein. Aus. Und Ein. Und Aus. Gott, ist das langweilig. Am liebsten hätte ich jetzt ein Vanille-Glacé Ein. Und Aus.
So fertig. Achtzehn Minuten waren’s. Ganz okay für den Anfang.
Ich sitze wieder am PC. Und sage mir: heute ist mein Entscheidungstag. Und füge hinzu: immer noch. Doch es passiert auch weiterhin nix. Alles ist wie immer. Ich sitz am PC und tue, was ich immer tu: ich schreib. Doch weil heute mein Entscheidungstag ist, red ich mir ein, es sei nicht so wie immer, es sei ein ganz klein wenig anders, weil nämlich mein Bewusstsein doch ein klein wenig wacher ist als auch schon. Und genau das scheint das Problem: dass ich erwarte, es müsste anders sein, weil ich mir doch Mühe gebe.
Wenn Erwartungen töten könnten, wäre ich schon lange tot.
_______
Über Ross Macdonald und Warren Zevon
Ross Macdonald wieder zu lesen, bedeutet, auf Szenen und Dialoge wie diese zu stossen:
„Noch einen Scotch, Doktor?“ fragte Marco.
Er wandte sich mir zu: „Etwas habe ich in meiner zwanzigjährigen Arztpraxis gelernt. Man muss jeden seine eigenen Fehler begehen lassen. Früher oder später nehmen sie doch wieder Vernunft an. Wenn ein Mann erst einmal ein Lungenemphysem gesehen hat, hört er zu rauchen auf. Und die Mädchen mit schweren Anfällen von Romantik werden wieder realistisch. Genau wie meine liebe Frau hier.“
Eine massige Frau in einer Art Mantilla tauchte hinter uns auf. Ihr Dekolleté schimmerte wie Perlmutt durch die schwarze Spitze. Sie hatte üppiges blondes Haar und einen unzufriedenen Mund. Ich stand auf.
„Redet ihr über mich““ fragte sie. „Das schätze ich nicht sehr.“
„Ja, ich habe deine realistische Ader gelobt, Audrey. Alle romantischen Frauen werden eines Tages wieder realistisch.“
„Die Männer zwingen uns dazu“, entgegnete sie. „Hat Marco mir meinen Daiquiri gemixt?“
„Ja. Das ist Mr. Archer, ein Detektiv.“
„Wie aufregend“, sagte sie. „Sie müssen mir ihre Lebensgeschichte erzählen.“
„Ich habe als Romantiker begonnen und mich allmählich zum Realisten entwickelt.“
Sie lachte und trank ihren Daiquiri, dann gingen die beiden in den Speisesaal hinüber.
(aus: Geld zahlt nicht alles).
Ross Macdonald wieder zu lesen bedeutet auch, sich an eine Sehnsucht von Kalifornien zu erinnern, der auch Aufenthalte vor Ort nichts anzuhaben vermochten, weil man instinktiv die Vorstellung, die man sich gemacht, sich zu sehen entschieden hatte. Obwohl, Anlass am amerikanischen Traum zu zweifeln, hatte es immer wieder gegeben. Als, zum Beispiel, in einem „No Shirt, No Shoes, No Service“-Schnellimbiss in Strandnähe, dessen Theke im Freien stand, ein barfüssiger, hemdloser, jedoch Shorts tragender junger Mann, der nur schnell ein Eis kaufen wollte, weggewiesen wurde und, da er sich dies nicht gefallen lassen wollte, er bereits Minuten später von einem Streifenwagen abtransportiert wurde, fühlte man sich schon etwas seltsam berührt, hatte man doch mit Kalifornien immer verbunden, dass man da mehr dürfe als anderswo.
“Ken Millar made me realize that I wrote my songs despite the fact that I was a drunk, not because of it.” Warren Zevon, der Singer/Songwriter, hat das gesagt. Dass Ken Millar, wie Ross Macdonald im wirklichen Leben hiess, und Zevon einiges verbunden hat, mag man nur schon daraus ablesen, dass der Krimiautor den damals von der Trunksucht genesenden Songschreiber im Krankenhaus besucht hat.
He did not want to die by drink, which he described as a coward’s death, steht in einem Artikel auf Zevons website zu lesen.
Dry your eyes my little friend, let me take you by the hand. Songzeilen wie diese, oder auch diese: The eternal Thompson gunner still wandering through the night. Now it’s ten years later but he still keeps up the fight, drücken das Grundgefühl, das Zevon und MacDonald eigen ist, aus. Einzelgängerische Seelen, nachdenklich, voller Mitgefühl, kämpferisch.
I want to live alone in the desert, I want to live like Georgia O’Keeffe, I want to live on the Upper East Side, and never go down in the street. So beginnt Zevons Splendid Isolation. Viel Sehnsucht liegt in solchen Zeilen, nach Weite, Anonymität, Unspektakulärem, und dem Mut, das zu tun, was man als seine Bestimmung erahnt. Honesty and vulnerability sei seine Währung, hat Jackson Browne über den Freund gesagt.
Ross Macdonald starb 1983 im Alter von 68 Jahren im kalifornischen Santa Barbara, Warren Zevon 2003, im Alter von 56, in Los Angeles.
_______
Sich der Angst stellen
Als Heranwachsender die Überzeugung: es spielt keine Rolle, was du tust. Doch was du tust, das tue richtig. Also voll und ganz. Mit Überzeugung, mit Hingabe, mit Disziplin. Meine Schreiber-Helden als junger Erwachsener waren die kompromisslosen, getriebenen, wahnsinnigen Egos: Norman Mailer, Oriana Fallaci. Sie drückten aus, was ich zu der Zeit ganz unbedingt empfand. Engagiert für das Richtige, das menschlich Anständige sein, und was dieses war und ist, war immer schon und ist auch heute noch klar, und braucht für jemanden, der sich nicht darauf beschränkt, nur seinen eigenen Vorteil zu rechtfertigen, auch gar nicht weiter begründet zu werden.
Im Gymnasium: Eugène Ionesco, wegen La cantatrice chauve, und dem Journal en miettes. Kurz vor seinem Tod gab er dem deutschen Fernsehen ein Interview: Das Leiden sei ihm, Ionesco, ins Gesicht geschrieben, sagte der Moderator der Sendung einmal. Ob er nie an Selbstmord gedacht habe? Ionesco blickte direkt in die Kamera und erwiderte, was er jetzt sage, sei natürlich „strictement entre nous“, doch er sei sicher (er schaute gen Himmel), dass solches „ne l‘aurait pas plu au Seigneur“.
Und Peter Handke, nicht zuletzt seines Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms wegen – da war einer, der in andere Sphären und nicht dazu gehörte. Genauso empfand ich, und genauso empfanden fast alle anderen in meinem Alter.
Wenn wir schon bei den Büchern sind: von Charles Bukowski Aufzeichnungen eines Aussenseiters, von Jörg Schröder und Ernst Herhaus Siegfried, von Robert Pirsig Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten, da fand ich mich drin. Weil sie von Ausbrüchen handelten und diese nachempfindbar machten. Genauso wie – damals – die Rockmusik.
Geht es also darum, geht es ums Ausbrechen? Darum, die Faszination, das Kompromisslose, das Unbedingte wieder zu finden? Und wenn ja, wie findet man das?
Wenn ich es wüsste, würde ich es tun. Das sagt sich leicht, das schreibt sich auch leicht, doch ist es auch die Wahrheit? Ist die Wahrheit nicht vielmehr, dass ich schon wüsste, was zu tun wäre, doch fast ausschliesslich damit beschäftigt bin, Gründe zu finden, um es nicht tun zu müssen? Aus Bequemlichkeit natürlich. Weil ich meinen Hintern nur bewege, wenn ich muss. Und aus Angst. Rollo May schreibt in seiner Antwort auf die Angst, eine der Hauptursachen der Angst – besonders bei der jüngeren Generation – liege darin, „dass keine verbindlichen kulturellen Werte als Basis für den Bezug zur Welt zur Verfügung stehen.“ Einverstanden. Doch da ist noch eine andere Angst, eine Ur-Angst vor dem Leben.
Nur sehr selten gesteht jemand, Angst vor dem Tod zu haben. Die meisten sagen, sie hätten Angst vor einem langen Sterben, aber vor dem Tod, nein, vor dem Tod nicht, denn den erlebe man ja auch gar nicht mehr. Das Argument leuchtet ein, doch empfinden diese Leute auch so?
Ich selber habe Angst vor dem Tod. Wie ich vor allem Unbekannten Angst habe. Auch weil, wie Otto Steiger einmal eine seiner Romanfiguren hat sagen lassen, ich mir schlecht vorstellen kann, wie es auf diesem Planeten weitergehen soll, wenn ich einmal nicht mehr bin. Und auch, weil mir die ganze menschliche Existenz, trotz Gefühlen des Staunens, und manchmal der Ergriffenheit, über das Wunder des Lebens, letztlich unheimlich ist.
Wer auf ein erfülltes Leben zurückblicken könne, fürchte auch den Tod nicht, hört man oft gesagt. Nur, was soll das bloss sein, ein erfülltes Leben? Viel gemacht und erlebt und seine Konkurrenten hinter sich gelassen zu haben, von den Nachbarn beneidet zu werden? Denn nur von solchen Leuten ist dieses Argument zu hören. Zumindest in den Medien. Doch das liegt vielleicht an den Medien, in denen nicht besonders Publizitätssüchtige kaum einmal vorkommen. Andererseits ist es eben auch so: Wer viel hat, will noch mehr und kann nie genug kriegen. Sei‘s Geld, Sex, Ansehen, bereiste Länder, gerettete Menschen oder gelesene und ungelesene Bücher.
Trotzdem: Sieht man ab vom derzeitigen Quantitätsdenken (War das wirklich jemals anders? Ist es heute nicht einfach nur offensichtlicher, vielleicht auch ausgeprägter, moralisch akzeptabler?), könnte ein erfülltes Leben nicht auch bedeuten, ein intensiv erfahrenes, das Kommen und Gehen von Augenblicken begrüssendes, ein nicht auf Haben, sondern auf Sein ausgerichtetes?
Dazu eine Geschichte: Zwei Mönche sind auf dem Weg zum Kloster. Der Monsunregen hat die Strasse unter Wasser gesetzt. Eine schöne junge Frau in einem neuen, weissen Kleid steht am Strassenrand. Sie zögert die Strasse zu überqueren, weil sie nicht will, dass ihr Kleid nass wird. Der eine Mönch geht auf sie zu, nimmt sie auf die Arme und trägt sie über die Strasse. Die beiden Mönche setzen ihren Weg fort. Nach geraumer Zeit kann der eine nicht mehr an sich halten und er sagt: „Du weisst doch, dass es uns nicht erlaubt ist, Frauen zu berühren. Wie hast Du das nur tun können?“ „Trägst Du sie immer noch mit dir mit?“ erwidert dieser, „Ich habe sie auf der anderen Strassenseite abgesetzt.“
Ein Theologe, oder ein Ethiker, ich erinnere mich nicht mehr genau, vielleicht war er auch beides (das eine schliesst das andere ja nicht aus), auf die Frage, was für einen Tod er sich wünsche: Keinen abrupten, durch einen Unfall zum Beispiel; einen, auf den er sich vorbereiten könne.
Mein Freund Armando hat so einen Tod gehabt. Als er mit ALS diagnostiziert wurde und wusste, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hatte, versuchte er es auch mit alternativen Heilmethoden. Vor allem aber begann er, zusammen mit Myriam, seiner Frau, ernsthaft zu meditieren. Bei spirituellen Meistern in Mailand, in Chonburi, in Borobodur und in Kathmandu. In Chonburi besuchte ich sie einmal. Während einer Audienz bei ihrem Meister, erzählte Armando, hätte dieser hervorgehoben, dass das Wichtigste das tägliche Üben sei. Klar, einverstanden, doch Myriam und Armando hatten noch viele Fragen, die sie gerne beantwortet gehabt hätten. Sie baten ihren Übersetzer, einen jungen, des Englischen einigermassen mächtigen, Mönch, diese dem Meister vorzutragen. Dessen Antwort nahm gute zehn Minuten in Anspruch und wurde vom Übersetzer mit dem einen Satz zusammengefasst: „He said you should practise.“ „Und sonst?“ „He said you should practise.“Armando hat sich vorbereiten können und die Chance genutzt. Manchmal verzweifelt, manchmal gelassen. Meist mit Humor. Damit er spirituell nicht allzusehr abhebe, lese er von Zeit zu Zeit seine Bankauszüge, meinte er.
Der Gang zur Guillotine, sagt Dr. Johnson, „helps wonderfully to concentrate the mind.“
In Fjodor Dostojewskijs Der Idiot lässt Fürst Myschkin einen die Vollstreckung seines Todesurteils Erwartenden sagen „Wenn ich doch nicht sterben müsste! Wenn das Leben zurückkehren könnte! Welch eine Unendlichkeit! Und alles wäre mein! Dann würde ich jeden Augenblick in eine Ewigkeit verwandeln, ich würde nichts vergeuden, mit jeder Minute geizen und ganz gewiss keine umsonst verstreichen lassen!“ …“…wie ging es mit Ihrem Bekannten weiter, der Ihnen diese Leidensgeschichte erzählt hat? … Er wurde doch begnadigt? Folglich wurde ihm dieses ‚unendliche Leben‘ geschenkt. Nun, was hat er mit diesem Reichtum angestellt? Hat er wirklich ‚mit jedem Augenblick gegeizt‘?“ „O nein, er hat es mir selbst erzählt – ich hatte ihn danach gefragt – , er hat keineswegs so gelebt und viele, sehr viele Augenblicke vergeudet.“ „Nun, dann haben Sie also den Beweis, dass es nicht möglich ist, so zu leben und in der Wirklichkeit ‚mit jedem Augenblick zu geizen‘. Aus welchem Grund auch immer, aber es ist nicht möglich.“ „O ja, aus welchem Grund auch immer“, wiederholte der Fürst, „das schien mir auch so … Und trotzdem möchte man es nicht glauben …“
Ich selber stehe nicht an der Schwelle zum Tod – höchstens in dem Sinne, dass man das immer tut, und das zählt nicht, weil unser ganzes Verhalten davon gänzlich unberührt bleibt – , kann also noch gar nicht auf mein Leben zurückblicken. Anders gesagt: ich habe doch noch gar nicht angefangen zu leben. Ich war bis jetzt auch gar noch nicht bereit dazu – und verstehe auch gar nicht, wie das Spiel hat anfangen können, ohne dass ich jemals gefragt worden bin, ob ich auch mitspielen wolle.
Sollte dies allzu weinerlich, zu infantil geradezu, geklungen haben: Die „Jetzt reiss dich zusammen“ und “Jetzt stell dich nicht so an“ und „Get real“-Sprüche, die kenne ich alle auch, mit denen habe ich mich oft genug in die Schranken verwiesen.
Was mehr hilft sind die Weisheiten meines im Alter von 96 verstorbenen Freundes Wamse: „Rasch tritt der Tod den Menschen an, und meist von links hinten.“
Die burmesische Friedensnobelpreisträgerin Aung San Su Ki, die sich in schöner Regelmässigkeit den Anordnungen der im Lande herrschenden Militärs widersetzt, wurde einmal in einem Interview gefragt, ob sie denn dabei keine Angst empfinde. Doch, natürlich, erwiderte sie. Doch es komme darauf, sich dieser Angst zu stellen und, auch wenn einem die Knie dabei schlotterten, zu tun, was getan werden müsse.
Auch wenn ich dieser Frau gegenüber nicht wenige Vorbehalte habe (sie hält sich, und ihre Familie, wie ich gelesen habe, offenbar für Auserwählte – hier anzumerken ist meine Neigung, Argumente von Neidern grundsätzlich wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen), ihr Verhalten ist mir Vorbild, denn sie redet nicht nur, sie setzt ihre Überzeugung auch in die Praxis um. Matthäus 7, 16: „An den Früchten sollt ihr sie erkennen.“
Doch es ist nicht nur Lebens- und Todesangst, die blockiert. Es ist da auch ein verzweifelte Wut darüber, dass man hier nicht ewig bleiben kann und sterben muss. Ich will nicht behaupten, dass ich ein ewiges Leben sinnvoll fände, ich will nur sagen, dass mich die Tatsache, dass es auf dieser Erde keines zu geben scheint, mit Panik erfüllt. Im umgekehrten Fall wäre es vermutlich genauso.
Von Elias Canetti habe ich einmal gehört, dass er den Tod nicht akzeptiere. Da er damals in Zürich an der Klosbachstrasse und ich am Kreuzplatz gewohnt habe – und ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand, der so nahe wohnte, grundsätzlich Wesentliches hätte äussern können – , reagierte ich auf diese Aussage mit der landesüblichen Häme: „Der nimmt sich halt schon wahnsinnig wichtig, der.“ Das würde ich auch heute noch so sagen, doch ohne Häme. Vielmehr mit Sympathie.
Schon als Bub die schmerzliche Frage: Wie kann jemand nur ein Haus bauen wollen, wenn es nicht für ewig sein kann? Auch deswegen: lieber Gitarre und nicht etwa Klavier lernen, weil man die Gitarre jederzeit überall hin mitnehmen konnte. Und am allerliebsten: mich auf Bahnhöfen und Flughäfen aufhaltend.
Dieses Muster ist mir seit je bestimmend gewesen: Unterwegssein, immer wieder neue Anfänge machend und dabei gleichzeitig die tiefe Sehnsucht nach Endgültigem, Ewigem, von Örtlichkeiten unabhängig.
Eric Ambler, der lange in Clarens, oberhalb von Montreux, wohnte, auf die Frage, wo er am liebsten leben würde: Immer gerade da, wo er zur Zeit nicht sei.
Natürlich weiss ich, was ich zu tun hätte. Das, was ich andern rate, dass sie tun sollten. Einen Fuss vor den andern zu setzen. Mutig sein, etwas wagen. Wesentlich werden. Allerdings: „We are none of us very good at taking our own advice“(John Simpson: Strange Places, Questionable People).
Die österreichische Schriftstellerin Ilse Aichinger auf die Frage „Welche natürliche Gabe hätten Sie gerne?“ „Auf der Welt sein zu können“, antwortete sie. Gelassen zu bleiben. Denn dies sei vor allem deswegen eine Kunst, weil man dazu gezwungen sei.
„Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.“ Dieses Gebet stand bei meiner ersten Arbeitsstelle auf meinem Pult, mein Vorgänger hatte es da hinterlassen. Damals interpretierte ich es als Rechtfertigung konservativer Politik (Nur keine Veränderungen!), später nahm ich es resignativ (Man kann eh nichts machen), noch später, sehr viel später, entdeckte ich darin das Wörtchen ‚Mut‘.
Ionesco und ich
Der am 26. November 1909 in Slatina geborene, ab 1938 in Paris lebende, Eugène Ionesco war einer meiner Jugendhelden. Und obwohl mir weder sein Werk noch sein Werdegang besonders vertraut sind und obwohl ich schon lange keine Helden mehr habe, fühle ich auch heute noch eine besondere Sympathie für diesen Mann. Das hat einerseits, so stelle ich mir vor, mit einer Aufführung von 'La cantatrice chauve' in einem Berner Kellertheater (das ist jetzt mehr als dreißig Jahre her), bei der ich Tränen gelacht habe, zu tun und andererseits mit seinen Tagebüchern ('Journal en miettes'/'Présent Passé Passé Présent'), die ich gelegentlich zur Hand nehme, wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie gut mir das, was ich damals unterstrichen habe, immer noch gefällt, wie stark ich mich noch immer damit identifizieren kann. Beispiele aus 'Présent Passé Passé Présent', 1968:
"Alles, was Autorität ist, schien mir ungerecht und ist es auch … Ich weiß, dass jede Rechtsprechung ungerecht ist und jede Autorität willkürlich, selbst dann, wenn diese Willkür durch einen Glauben oder aber durch eine leicht zu entlarvende Ideologie gestützt ist. Die neuen Autoritäten sind ebenso ungerecht, ebenso unannehmbar wie die alten, denn sie werden durch Menschen verkörpert, das heißt durch persönliche und subjektive Leidenschaften, deren theoretische Objektivität mich nicht täuscht. Die offizielle Stellung, die Orden, die Ehren, das Verdienst maskieren nur Schandtaten und abgrundtiefe Dummheit."
"Was ich unannehmbar finde, sind die Bedingungen unserer Existenz. Auf der Erde zu sein, ist nicht annehmbar. Nicht verstehen zu können, ist unannehmbar, und wir können nicht verstehen, da die Endgültigkeit in unserem Wesen liegt."
Zugegeben, die beiden Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Doch Zusammenhänge, die ja schließlich nichts anderes als recht beliebige Konstrukte sind, interessieren mich nicht eigentlich. Und je länger, je weniger. Lese ich einen Text, so beschäftigt mich die Geschichte drumherum (wie das zeitlich und thematisch einzuordnen ist etc., also das, womit an Universitäten Lehrende es schaffen, Geld zu verdienen) wenig, wichtig ist mir vielmehr, ob die Lektüre mich unterhält, meinen Horizont erweitert, mich etwas entdecken lässt, mich etwas lehrt, mir zeigt, dass andere ganz ähnlich denken und empfinden wie ich selber auch. Dazu genügen oft kurze Passagen, Bruchstücke, einzelne Sätze – Shakespeares "The readiness is all", zum Beispiel, begleitet mich schon seit Jahren.
Je subjektiver sich jemand ausdrückt, desto größer die Chance, dass wir uns (da wir viel weniger einzigartig sind als wir gemeinhin annehmen) damit identifizieren können. Hier ein Beispiel aus Ionescos Jugend:
"Ich finde alte Tagebuchseiten, sie stammen aus … reden wir nicht davon. Sie sind so alt, dass mir schwindlig wird. Ich hatte eigentlich noch so gut wie nichts veröffentlicht, noch kein Theaterstück geschrieben, höchstens Dialogfetzen. Ich hatte dieselben Probleme, ich habe immer dieselben Probleme gehabt. Ich bin heute wie damals und wie von jeher unfähig, eine Antwort zu geben. Ich habe nichts gelöst; ich bin immer noch beim Fragen. Im Fragezustand bin ich, wenn das Bewusstsein wach ist. Sonst ist es das Vergessen, der Schlummer der Intelligenz. Hier also sind diese Seiten:
Es kommt vor, dass ich ab und zu aufwache, bewusst werde, merke, dass ich von Dingen und Leuten umgeben bin, und wenn ich sehr aufmerksam den Himmel oder auch die Wand oder auch den Boden oder auch diese Hand betrachte, die schreibt oder nicht schreibt, da kommt es vor, dass ich den Eindruck habe, ich sähe all das zum ersten Mal. Dann frage ich mich oder frage, als sei es das erste Mal: 'Was ist das?' Ich sehe mich um und frage: 'Was sind all diese Dinge? Wo bin ich? Wer bin ich? Was ist diese Frage?' In solchem Moment überflutet ein plötzliches Licht, ein starkes, blendendes Licht alles, lässt die Schatten unserer Sorgen, alle Schatten überhaupt verschwinden, das heißt alle Mauern, die bewirken, dass wir uns Grenzen, Unterscheidungen, Trennungen, Bedeutungen vorstellen und ausdenken. Es gelingt mir dann nicht einmal mehr, mir zum Beispiel die Frage zu stellen: Was ist die Gesellschaft? Oder auch irgendeine andere Frage, weil ich nicht über die erste, fundamentale Frage hinwegkomme, über das blendende, glühende Licht, das aus der Frage geboren ist, ein so starkes Licht, dass es alles umfasst, verbrennt, dass es, möchte man sagen, alle Dinge auflöst. Nur eine irrsinnige Liebe, ohne Objekt, kann dem blendenden Licht der Frage standhalten, und diese irrsinnige Liebe verwandelt sich, wächst, wird zu einer grundlosen Euphorie und scheint das Weltall in Flammen zu setzen." (Journal en miettes 1967).
Genau diese fundamentalen Fragen (mit der Erfahrung von grundloser Euphorie, doch ohne das Erlebnis dieses brennenden, glühenden Lichts) haben mich letzthin auf langen und meist ereignislosen Busreisen durch den Nordosten Brasiliens intensiv beschäftigt (auch, weil das Licht in den Hotels zum Lesen, das mir nicht zuletzt Halt gibt, nicht geeignet war, ich mich also nicht von dem, was einfach nur ist, ablenken konnte): Wer sich darauf einlässt, "alle Mauern, die bewirken, dass wir uns Grenzen, Unterscheidungen, Trennungen, Bedeutungen vorstellen und ausdenken" für einmal wegzulassen, macht in der Tat Erfahrungen, die einen Fragen wie "Was ist die Gesellschaft?" vollkommen absurd vorkommen lassen. Oder eben ganz einfach: "Es ist sehr einfach. Die Welt muss von denen regiert werden, die es interessiert, sie zu regieren. Wer verdient es, die Welt zu regieren? Diejenigen, die es interessiert, diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen. Mich interessiert es nicht." (Présent Passé Passé Présent’, 1968).
Seit Jahren beschäftigt mich, wie die Medien unser aller Wirklichkeit im Namen derer, die das Sagen haben, herstellen. Nicht bewusst war mir dabei lange Zeit, dass all das, was ich dabei erkannte, ich schon vor vielen, vielen Jahren gedacht habe und dass seither kaum eine wesentlich neue Erkenntnis hinzugekommen ist. Wie Ionesco habe ich mein Leben lang dieselben Probleme (und auch immer dieselben Fragen und dieselben Erkenntnisse) gehabt:
"Wie könnte unwahr sein, was in den Zeitungen steht? Es ist fürchterlich zu wissen, dass alles von einer kleinen herrschenden Gruppe bestimmt wird, dass alles, was in den Zeitungen steht, bewusst gelenkt, dann unbewusst von anderen übernommen wird, und dass der Masse das Gift als Nahrung dargeboten wird" ('Présent Passé Passé Présent', 1968).
Kurz vor seinem Tod gab Ionesco dem deutschen Fernsehen ein Interview: Das Leiden sei ihm ins Gesicht geschrieben, sagte der Moderator der Sendung (der sich offenbar für außergewöhnlich einfühlsam hielt) einmal. Ob er nie an Selbstmord gedacht habe? Ionesco blickte direkt in die Kamera und erwiderte, was er jetzt sage, sei natürlich "strictement entre nous", doch er sei sicher (er schaute gen Himmel), dass solches "ne l‘aurait pas plu au Seigneur."
Erstveröffentlichung im Aurora-Magazin, Salzburg 2007
________
Von den Büchern
Ich bin ein Buch-Süchtiger. Schaufenster von Buchhandlungen, Bücherkisten mit herabgesetzten Exemplaren ziehen mich magisch an, doch die ultimativen Antörner sind die Grossbuchhandelsketten à la Waterstones, Borders und Barnes & Noble – was gibt es Tolleres als bei Cookies und Cappucino bei Powells in Portland, Oregon, zu stöbern, wo man sich gleich auf mehreren Stockwerken verlieren und Schnäppchen machen kann, die einen die Seele jauchzen, das Herz hüpfen und die Augen leuchten lassen.
Ich muss Bücher besitzen, möglichst neue, noch von niemandem gelesene. Lesen? Natürlich, auch, doch das ist nicht das Wichtigste. Sie aufgereiht im Büchergestell betrachten zu können, sich in guter, ja exzellenter Gesellschaft zu wissen, ist eindeutig der grössere Kick.
Ich besitze, zum Beispiel, fünf Bücher von Maxine Hong Kingston. The Woman Warrior, China Men und Tripmaster Monkey. Die erste Ausgabe von The Woman Warrior habe ich einem Second-Hand Laden in Kathmandu gekauft, am 7. Januar 1990 (habe ich ins Buch reingeschrieben); die zweite, eine Hardcover-Ausgabe, im Februar 1997 (das war in USA, entweder in Santa Fé oder in Portland) – ich habe bis jetzt keines der beiden Exemplare gelesen, zumindest nicht vollständig, bin jedoch überzeugt, dass dieses Buch ein wirklich ganz wichtiges, bedeutsames sein muss. Nicht zuletzt der Dinge wegen, die über dieses Werk geschrieben worden sind. Das Gleiche gilt für China Men (auch dieses besitze ich doppelt – in identischer Ausführung). Stellvertretend für viele sei John Leonard von der New York Times zitiert: „Four years ago, I said The Woman Warrior was the best book I‘d read in years. China Men is, at the very least, the best book I‘ve read in the four years since.“
Ich erinnere mich, dass, als ich zum ersten Mal den Namen Maxine Hong Kingston gelesen habe, er mich elektrisierte, mir – das war bevor das Multikulturell-Geschwätz allüberall gegenwärtig war – eine Kulturvermischung suggerierte, die mich faszinierte, begeisterte, verheissungsvoll dünkte. Und dann sah ich ein Foto von ihr, und was ich darauf sah, gefiel mir und mehr noch als zuvor wusste ich, dass ich ihre Bücher gut finden würde.
Halte ich eine Zeitung oder eine Zeitschrift in der Hand, suche ich sofort das Feuilleton und da die Buchbesprechungen. Die Sonderausgaben zur Buchmesse sammle ich, ebenso Exemplare, in denen Prominente angeben, was sie lesen oder zu lesen empfehlen. Nicht, dass ich diesen Empfehlungen dann auch Folge leisten würde. Genauer: es kommt drauf an, wer was empfiehlt – von mir unsympathischen Zeitgenossen lasse ich mich nur schwer zur Lektüre anregen (um mir selber zu beweisen, dass ich damit falsch liege, tue ich es manchmal doch und ohne, dass ich es bisher zu bereuen gehabt hätte). Überhaupt lasse ich mir nur ungern Bücher empfehlen, lieber finde ich sie selber; und noch lieber bilde ich mir ein, dass ich an einige der mir ganz besonders lieben heran gelaufen bin, so, als ob nicht ich sie, sondern sie mich gefunden hätten (dies eine meine Lieblingsvorstellungen überhaupt: dass es nur darauf ankomme, bereit zu sein für sein Schicksal). Oh, diese Manie, speziell, anders als alle andern sein zu wollen – also diejenigen Bücher haben zu wollen, die andere verschmäht, nicht erkannt haben. Das Gedächtnis der Wälder von Charles T. Powers, zum Beispiel, lag in einer Ramsch Kiste vor einem Antiquariat. Die Handlung spielt in Polen und ich hatte beim Lesen immer die Aussicht auf diese Wälder vor Augen, zu denen ich mit Holger, der in Prag arbeitet und an der Grenze eine kleine Datscha besitzt, hinaufgefahren bin. „Da drüben, das ist Polen“, hat er Richtung Norden gezeigt. Ich habe das Buch unterwegs, im Zug, gelesen. „Ich habe gelesen, damit ich nicht darüber nachdenken muss, wo ich hier bin“, habe ich mir damals angestrichen.
Ein Buch gibts, das habe ich mehrere Male gelesen (das einzige). Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten von Robert Pirsig. Es handelt von einer Motorradreise durch Amerika und vom Versuch, Qualität zu definieren.
Ich weiss noch genau, wie ich auf dieses Buch gekommen bin. Ich las damals regelmässig Sounds, ein Musikmagazin aus Hamburg, in welchem auch Jörg Gülden und Helmut Salzinger schrieben. Was die beiden zu Papier brachten, fand ich gut. Grundsätzlich. Die waren keine Anpasser, fand ich. Dies schloss ich aus der Sprache, der Art, wie sie schrieben. Der Gülden schwärmte für Little Feat und schrieb, dass Bat out of Hell von Meatloaf das Rockalbum überhaupt sei. Da gibt es nichts hinzuzufügen, das stimmt einfach. Und dann stand im Sounds eines Tages auch eine positive Besprechung von Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten. Und weil diese im Sounds stand, glaubte ich, dass sie wahr war. Und habe es nicht bereut. Und wenn der Pirsig heute auf dem Umschlag von Steve Hagen‘s Buddhism Plain & Simple mit „This is the clearest and most precise exposition of Buddhism I have ever read. If you‘re looking for enlightenment rather than just scholarly knowledge, you‘d better read this“ zitiert wird, dann kauf ich dieses Buch, auch wenn ich mir gerade Minuten zuvor gesagt habe, ich hätte doch wahrlich genug Bücher über Buddhismus gelesen und würde jetzt ganz bestimmt nicht noch ein neues kaufen – auch hier hat es sich gelohnt. Wegen Einsichten wie dieser: „The message is always to examine and see for yourself . When you see for yourself what is true – and that‘s really the only way that you can genuinely know anything – then embrace it. Until then, just suspend judgement and criticism. The point of Buddhism is to just see. That‘s all.“
Die meisten Bücher, die ich damals las, las ich nicht unbedingt des Inhalts wegen. Handkes Die Angst des Tormanns beim Elfmeter oder Der kurze Brief zum langen Abschied zogen mich an, weil mich die Titel anregten (und, bei letzterem, das Paperback-Format – das Buch lag ganz wunderbar in der Hand – sowie die Umschlagsgestaltung), so sehr, dass ich bereit war, was auch immer die Geschichte sein würde, sie gut zu finden. Natürlich, das hatte auch mit der Person von Peter Handke zu tun. Ich hatte ihn in einer Fernsehsendung über sein Theaterstück Publikumsbeschimpfung gesehen. Er hatte längere Haare, ein Jura-Studium abgebrochen und er wollte provozieren – das gefiel mir, war mir sympathisch.
Jahre, und einige Handke-Bücher später, arbeitete ich in einem Verlag und wollte ein Buch mit der Journalistin Renate Possarnig machen. Ich hatte ein Buch von ihr über Gaddafi gelesen (ich erinnere von dem Buch nur noch die erste Seite – sie handelte vom Flug von Larnaca nach Beirut) und wusste, dass sie als Kriegsberichterstatterin für den ORF im Libanon gewesen war. Mir schien sie eine österreichische Oriana Fallaci und mir schwebte ein Pendant zu Fallacis Vietnam-Buch vor. Als wir uns dann in Wien trafen, schlug sie mir jedoch Interviews mit österreichischen und griechischen Künstlern (sie lebte zu der Zeit in Griechenland) vor. Einer dieser Interviewpartner war Peter Handke. Und der sagte dann so Sachen wie, zum Beispiel, übers Kochen, genauer, übers „Essen-Zubereiten – ich sage nicht gern kochen“, dabei sagte er also: “Ich schaue, dass ich möglichst vornehm gekleidet bin. Meistens mit einem zweireihigen Anzug. So steh ich dann in der Küche und rieche dann an den Gurken herum, an jedem Ding, am Holunder …“ Er ist ja schon sehr esoterisch, der Mann, so dass man sich durchaus vorstellen kann, dass er auch ernsthaft meint, was er da sagt. Andererseits ist er nicht ohne Humor. „An einem Rinnsal, dessen kaum fliessendes Wasser schwarz von hineingewehten Blättern ist, paaren sich gerade zwei Truthühner, deren männlicher Teil danach zur Seite torkelt, einknickt und zu Boden fällt“, schreibt er in der Kindergeschichte. Also ich für meinen Teil nehme das mit dem Essen-Zubereiten im Zweireiher nicht ohne Wohlwollen und mit Schmunzeln zur Kenntnis. Und kann mich gleichzeitig doch nicht recht freimachen vom Gefühl, dass des Meisters Bedürfnis nach Heiligung alltäglicher Verrichtungen schon auch ziemlich lächerliche Züge zeitigt.
Nach langer Handke-Pause, an Weihnachten 1994, beginne ich Mein Jahr in der Niemandsbucht zu lesen. Schon nach ein paar Seiten stehen da die ersten Sätze, die meine eigene Befindlichkeit auf eine Weise auf den Punkt bringen, wie ich es selber wohl kaum vermöchte.
„Ich lebte kaum mehr mit meiner Zeit, oder ging nicht mit, und da mir nichts je so zuwider war wie die Selbstzufriedenheit, wurde ich zunehmend gegen mich aufgebracht. Welch ein Mitgehen hatte sich zuvor ereignet, was für eine grundandere Begeisterung war das gewesen, in den Stadien, im Kino, auf einer Busfahrt, unter Wildfremden. War das ein Dauergesetz: Kindliches Mitgehen, ausgewachsenes Alleingehen?
Ich freute mich an meinem Alleingehen und war doch bedürftig des Mitgehens; und füllte jene Freude mich einmal aus, entbrannte ich nach den Abwesenden: Ich sollte die Fülle, damit diese gelte, augenblicklich mit ihnen teilen und weiten. Die Freudigkeit in mir konnte nur heraus in Gesellschaft, freilich in welcher?
Indem ich für mich blieb drohte ich zu verkümmern. Die neue Verwandlung wurde dringlich. Und anders als jene erste, die mich hinterrücks befallen hatte, würde ich sie diesmal selber in Gang setzen. Die zweite Verwandlung stand in meiner Macht. Nicht mit einer Verengung finge sie an, sondern mit meinem entschlossenen und zugleich bedachtsamen Mich-weit-und-weiter-Machen. Nichts Dramatisches wollte ich dabei, rein eine Schritt für Schritt bestimmende Stetigkeit.“
Mir bedeutete Handke immer: dass Alltägliches bedeutsam wurde.
Ich erinnere mich an ein orangenes Suhrkamp Taschenbuch von ihm mit Fotos von Belleville, das ich während meiner Gymnasialzeit besass. Titel und Inhalt sind mir entfallen. Geblieben sind mir die Fotos, auch weil sie so gänzlich unspektakulär waren. Ein verlassener Platz; eine Treppe, die zu einer U-Bahnstation führte. Alles grau in grau, eine Betonwüste, ich fühlte mich angezogen – es war so anonym, so banal, so gänzlich unbesonders, dass ich mich gleichzeitig traurig und frei fühlte.
Neben Handke gibt es noch andere Schriftsteller, die ich mich einmal entschieden habe zu mögen. Monika Maron gehört dazu. Flugasche war das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Und gefallen hat es mir, weil auch die politischen Kontrahenten der Hauptperson, der Journalistin Josefa Nadler (der meine Sympathie gehörte) als intelligent und ernstzunehmend dargestellt wurden – jedenfalls in meiner Erinnerung. Gefallen haben mir aber auch die Fotos, die die Autorin Monika Maron zeigten – eine schöne Frau, immer sehr ernst, melancholisch.
Die Fotos, die ich von Robertson Davies kenne, zeigen ihn meist als bärtigen Schalk. Clever, lehrreich und witzig sind seine Werke. Mit so ganz wunderbaren Sätzen wie diesem: „He went, as smart a murderer as you can hope to meet in a day‘s march, though his face was tense with pain. But then, who notices when they meet a theatre critic whose face is tense with pain? It is one of the marks of the profession.“ (Murther and Walking Spirits). Die Einsichten, die ich diesem Mann verdanke, sind zahlreich und begleiten mich. Zwei seien hier genannt: „His reply had that clarity, objectivity and reasonableness which is possible only to advisors who have completely missed the point“ (A Mixture of Frailties). Und: „I‘ve had a good deal of experience, and I‘ve always found that you get the best out of people by being decent to them“ (Tempest-Toast).
Sicher, jemand der schreibt, sollte vor allem schreiben können und muss nicht notwendigerweise toll aussehen. Andrerseits ist es eben doch auch so, dass wenn ich einen ausgesprochen feurigen Text gelesen habe und es sich dann herausstellt, dass es sich beim Verfasser um einen bleichen Arthritiker mit Mundgeruch handelt, ich mich dann, na ja, also ich lese dann den Text mit anderen Augen. Zugegeben, das ist nicht fair. Doch so ist das Leben, also gut: mein Leben. Deswegen: Es ist wohl besser, Autoren, deren Bücher man schätzt, nicht kennenzulernen.
Natürlich stimmt das so nicht – einige, von denen ich Bücher herausgebracht habe, erwiesen sich auch privat als überaus beeindruckende Menschen. Und trotzdem: Letzthin bin ich auf das Bild eines Autors, dessen Buch ich begeistert verschlungen hatte, gestossen und wusste sofort, dass ich, hätte ich dieses Bild vorher gekannt, die Lektüre gar nicht erst angefangen hätte.
Hier ein Zeitungsartikel über Ludwig Hohl. Einige seiner Notate habe ich, in jungen Jahren, gelesen, weil er eigenbrötlerisch war, mir als grosser Einsamer erschien. In Genf hat er gelebt, in einem Keller, und hat die vollgeschriebenen Zettel an einer Wäscheleine, die quer durch den Raum gespannt war, aufgehängt. Wozu wohl?, doch das frage ich mich erst heute. Nicht, weil mich die Antwort besonders interessierte, mehr, weil ich mich wundere, dass ich mich das damals nicht gefragt habe.
Meine intensivste Lesezeit, da war ich in meinen Zwanzigern, verbrachte ich mit Hubert Selby – nie sind mir Schilderungen von Obsessionen so nahe gegangen, nie, dass mir sonst einmal eines Buches wegen – vor allem: Der Dämon – schwarz vor Augen geworden wäre. Nur Nietzsches Also sprach Zarathustra (das war noch während des Gymnasiums) hat mich ähnlich verstört. Mir war, als ob sich Abgründe aufmachten, ich mich nirgendwo mehr festhalten, nur noch ins Bodenlose stürzen würde.
Von den Büchern, die ich im Laufe der Jahre gelesen habe, könnte ich selten einmal widergeben, wovon sie gehandelt haben. Ganz im Gegenteil zu professionellen Kritikern, die mir jeweils den Inhalt, das Gelungene und weniger Gelungene sowie den Hinweis, wie das Buch hätte geschrieben sein müssen, darzubieten im Stand sind. Bei mir selber beschränkt sich die Erinnerung meist darauf, ob mich ein Buch gefangengenommen, in seinen Bann gezogen hat. Toni Morrisons Song of Solomon, wo auch dieser Satz drinsteht: „Serious is just another word for miserable.“ Ich weiss, ich weiss, es geht nicht an, einen solchen Satz einfach aus seinem Zusammenhang zu reissen. Und ich weiss auch, dass dieses Buch von Anderem handelt, dass da eine Geschichte erzählt, die … undsoweiter usw usw. Doch kümmert mich das wenig, denn diesen Satz habe ich angestrichen, weil er meine Pubertät so treffend zusammenfasst. So traurig mich das auch heute noch machen kann, ich fand damals unbeschwerte Mitschüler nur oberflächlich. Ein sensibler Mensch (ich, nur ich) war ernst und litt.
Den Song of Solomon habe ich auf Kuba gelesen, im Juli 1997, völlig absorbiert von der Geschichte und wäre, obwohl das ja zeitlich wirklich nicht so weit zurückliegt, überfordert, müsste ich denn sagen, worum es dabei gegangen ist. Doch ich erinnere Bilder: Eine Strasse, eine Häuserzeile, dass Innere eines Hauses, einen jungen Mann auf der Flucht in einem Sumpfgebiet. Und ich erinnere die Zuneigung, die ich für die Menschen, die in dieser Geschichte auftraten, verspürte.
Eines meiner stärksten Leseerlebnisse war Ayn Rands The Fountainhead. Es handelt von einem Architekt mit einer Vision – soviel erinnere ich noch. Doch was ich noch ganz genau weiss, ist, wo ich dieses Buch gelesen, wie ich mich zu der Zeit gefühlt hatte.
Ich war damals 27 und hatte mit Beni (der sich heute Benedetto nennt) zusammen für wenig Geld ein Auto gekauft, um damit durch Frankreich, Portugal und Spanien zu fahren (Benis Cousine, deren Namen mir entfallen ist, war auch mit dabei). Wir hatten unsere Gitarren mit, spielten am Strand, in einem Restaurant (wo wir dafür gratis essen durften), einem Bordell und einer Disco im Süden Portugals, auf einem Geburtstagsfest in einer grossartigen marokkanischen Villa an der spanischen Mittelmeerküste und auf den Ramblas in Barcelona.
Die eindringlichste Erinnerung ist diese: Wie wir auf Ibiza jeweils den Bus zum Strand nahmen und ich die ganze Zeit – während des Wartens auf den Bus, der Fahrt, am Strand, der Rückfahrt – mich nur mit diesem Buch beschäftigte, der Geschichte eines Mannes, der seine Träume zu verwirklichen suchte.
Ständig bin ich umringt von einem mir selbst auferlegten Pflichtpensum, fast immer gegründet auf Besprechungen in Zeitungen und Magazinen, seltener wegen Anregungen aus dem Fernseher. Nicht, dass ich Kritikern, bezahlten Bücherlesern (das soll ein Beruf sein?) also, gegenüber positiv eingestellt wäre, ganz im Gegenteil. Hauptsächlich natürlich aus Neid (so möchte ich auch meinen Lebensunterhalt verdienen können), dann aber auch, weil mir Leute, die hauptberuflich mit Schöngeistigem zu tun haben, nicht viel Eindruck machen – sie sind mir zu sehr von des Gedankens Blässe angekränkelt, zu wenig sportlich. Auch ist es hilfreich, sich Fernsehsendungen zu Büchern anzuschauen, denn da sieht und hört man, wer da einem welche Bücher und warum nahe legt. Und noch jedesmal war es nach solchen Sendungen so, dass ich wusste, dass ich mir von solchen Leuten (es gibt Ausnahmen, sicher) keine Lektüre aufschwatzen lassen will, weil die nämlich alle (ja, ja, also dann: fast alle) so lehrerhaft, so von sich eingenommen und so beifallssüchtig wirken, dass man sich nur wundert, weshalb man den Apparat nicht einfach abstellt. In letzter Zeit habe ich bemerkt, dass ich genau dies immer öfter tue.
Ich erwarte mir von Büchern – hauptsächlich – eine Schärfung der Sinne. Und ich kriege sie auch. Von Graham Swift, zum Beispiel, der in Last Orders den Vic über den Beruf des Begräbnis-unternehmers nachsinnen lässt:
„ … it’s a privilege, to my mind, an education. You see humankind at its weakest and its strongest. You see it stripped bare of its everday concerns when it can’t help but take itself serious, when it needs a little wrapping up in solemness and ceremony. But it doesn’t do for an undertaker to get too solemn. That why a joke’s not out of place. That’s why I say: Vic Tucker, at your disposal.
It’s not a trade many will choose. You have to be raised to it, father to son. It runs in a family, like death itself runs in the human race, and there’s comfort in that. The passing on. It’s not what you’d call a favoured occupation. But there’s satisfaction and pride to it. You can’t run a funeral without pride. When you step out and slow-pace in front of the hearse, in your coat and hat and gloves, you can’t do it like your apologizing. You have to make happen at that moment what the bereaved and bereft want to happen. You have to make the whole world stop and take notice.”
Die ungelesenen Bücher um mich herum laden nicht nur zum Blättern ein, sie beschweren auch die Gestelle und mein Gemüt; sie drohen, mich unter ihnen zu begraben, mir den Atem zu nehmen.
Ich lese ohne Linie, wild durcheinander, oft gierig. Manchmal gerate ich in einen richtigen Sog, kann es kaum erwarten, weiter zu lesen, kann nicht genug kriegen, wie ein Süchtiger eben. Und wie jede Sucht nicht nur Leiden ist, sondern einem auch unvermutet Einsichten verschafft, so auch diese:
„Auf Briefmarken finden Sie die gesamte Geschichte der modernen Welt. Sie sind das einzige im alltäglichen Leben, das ein laufendes Protokoll der wichtigen Ereignisse führt, die eine Epoche definieren“ (Paul Benjamin: Aus für den Champion).
„Sie verabscheut Journalisten privat wie beruflich und meidet sie, wo es geht. Das hat nichts mit Rivalität zu tun. Sie kann nur ihre Selbstgefälligkeit, die versteckten Kumpeleien und die beschämende Grossspurigkeit, mit der sie auf ihre Neutralität pochen, nicht ausstehen.“ Und: „Am meisten habe ich mich, glaube ich, in sie verliebt, weil sie mir einen Weg versprach, aus mir selber herauszufinden“ (Ronan Bennett: Über den dunklen Fluss).
Auf Ronan Bennetts Buch bin ich in einem Zürcher Antiquariat gestossen. Ein Leseexemplar, gebunden, ungelesen, für fünf Franken – ich habe innerlich gejubelt. Der Autor war mir unbekannt, doch auf dem Umschlag gelobt von Nick Hornby, von dem ich zwar auch noch nie etwas gelesen, dessen Buchtitel mir jedoch geläufig sind. Es ist nicht meine Art, gerade erstandene Bücher sofort zu lesen, doch den Ronan Bennett nahm ich mir unverzüglich vor. Eine Geschichte aus den sechziger Jahren, aus dem Kongo, zur Zeit Lumumbas. Ein Ire folgt seiner Freundin, einer italienischen Journalisten, dorthin nach. Eine verzweifelte Liebesgeschichte, denn die Italienerin hat sich dem Unabhängigkeitskampf Lumumbas verschrieben, der Ire ist für diese Art von Engagement zu sehr Realist. Bei der Schilderung der Italienerin dachte ich oft an Oriana Fallaci – so musste die in jüngeren Jahren gewesen sein: wild, naiv, idealistisch, kompromisslos, fanatisch, eitel und durchgeknallt. Eine Wahnsinnige. Damit wir uns richtig verstehen: wahnsinnig meint hier keineswegs einen klinischen Begriff, möchte einen solchen aber auch nicht gänzlich ausschliessen. Wahnsinnig meint hier vor allem: unbedingt, ohne falsche Kompromisse.
„Versagen war keine Schande. Fehlender Mumm schon. Er musste es einfach drauf ankommen lassen. Oder es zumindest versuchen“ Die Sätze stehen in einem Krimi von Richard Hoyt mit dem Titel Marimba. Lese ich sie heute, denke ich, ja, ja, schon wahr, doch so besonders beeindruckend auch wieder nicht. Ob sie wohl im Zusammenhang …? Nein, nein, keine Textanalyse. Ich weiss genau, wieso ich diese Sätze mir angestrichen habe. Weil sie einfach, klar und direkt sind. Und Ermunterungen, Anweisungen zu handeln. Genau, was ich brauche, was mir Not tut.
Den Reportern gehört meine Zuneigung. Weil ich da sofort an Jack Nicholson in Antonionis Profession Reporter denke, genauer an Maria Schneider (und jetzt, als ich das so hin schreibe, an Maria Schneider in Last Tango in Paris), aber auch an Nicholson, alleine und verloren in wüstenähnlichen Gegenden. Denn das ist für mich ein Reporter: einer, der auf sich allein gestellt ist, nicht viel hat, und nicht viel braucht, ein Einsamer – so ziemlich das genaue Gegenteil eines Abteilungsleiters oder eines Chefredakteurs.
Natürlich rede ich nicht von den Fernsehreportern, ich rede von Leuten wie Norman Mailer und Tom Wolfe, von Oriana Fallaci und Dominick Dunne, von Christopher Hope und Rian Malan, von Honoré de Balzac und Emile Zola, von Leuten, deren Geschichten sich an der Wirklichkeit orientieren. Es sind dies Schreiber, die ihre Antennen ausfahren und hingucken, genau hingucken, und sich die dafür notwendige Zeit nehmen.
Nicht, dass diese Leute meinem idealisierten, einsamen Wolf entsprächen. Dominick Dunne, zum Beispiel, schreibt für Vanity Fair, ist Freund der Reichen (und Schönen, wirklich?) und folgt jeden Abend einer anderen Einladung. Was kann da schon Schlaues rauskommen? Doch dann las ich eines Tages in Time über Another City, Not My Own, Dunnes Buch über den O.J. Simpson-Prozess, das so beginnt: „Yes, yes, it‘s true. The conscientious reporter sets aside his personal views when reporting events and tries to emulate the detachment of a camera lens, all opinions held in harness, but the man with whom this narrative deals did not adhere to this dictum, at least when it came to the subject of murder, a subject with which he had a personal involvement in the past. Consequently, his reportage was rebuked in certain quarters of both the journalistic and the legal professions, which was a matter of indifference to him. He never hesitated to speak up and point out, in print or on television, that his reportage on matters of murder was cheered by much larger numbers in other quarters.“
Ich habe das Buch verschlungen, nicht zuletzt Dunnes parteiischer Subjektivität wegen: da ist von Anfang an kein Zweifel, dass Simpson des Mordes schuldig ist. Natürlich ist auch für Dunne dieser Prozess ein Medien-Spektakel, doch er ist mehr, weit mehr – es ist der Aufschrei eines zutiefst vom Mord an seiner eigenen Tochter getroffenen Mannes, eines Mannes, der bei aller Rigorosität seiner Sichtweise nicht aus den Augen verliert, dass es bei diesem Prozess nicht um Rassenfragen, sondern um die erschlagenen Nicole Simpson und Ron Goldman zu gehen hat.
Was mich interessiert ist Aufrichtigkeit, ungeschminkte Aufrichtigkeit, denn diese befreit. Und Authentizität. Und darum, vermute ich, geht es mir vor allem. Leon de Winter in seinem Buch Leo Kaplan:
„Recht dem Zweifel! Recht der Unsicherheit! Eine Welt verzweifelter Individuen, die nicht wissen, ob sie nach links oder nach rechts gehen sollen! Das ist meine ideale Welt!“ (…) „Er hatte gemeint: Ich möchte mein eigenes Leben leben, ich möchte ein Mensch sein, der Verrückte, Gorillas, Krokodile achtet, ich möchte mich nicht länger von einem blinden Verlangen nach Wahrheit bestimmen lassen`! So was in der Art. Aber er war sehr wohl auf der Suche nach Wahrheiten. Er wusste, dass es sie gab. Die Wahrheit des Todes, der Geburt, der Liebe. Die wollte er kennen, aus ihrer Verpackung nehmen …“
Genug
‚Warum müssen wir das eigentlich alles wissen? Die ganzen letzten Wochen gab’s nur zwei Themen, die Finanzkrise und die amerikanischen Wahlen. Warum müssen wir das wissen, was haben wir damit zu tun?’, fragt Daniele im Englisch-Konversationskurs. Daniele ist Anfang dreissig, hat ein abgeschlossenes Studium hinter sich und arbeitet in einem grösseren Industriebetrieb in Santa Cruz do Sul, einer Stadt mit 120'000 Einwohnern im südlichsten brasilianischen Staat, Rio Grande do Sul, der so gross ist wie Italien, doch nur gerade eine Bevölkerung von 10 Millionen aufweist.
Die Antwort ist einfach: wir müssen das alles gar nicht wissen. Warum sollten wir auch? Weil es uns die Medien sagen? Nun ja, die Medien sagen uns, was den Medieneignern nützt. Weil wir davon betroffen sind? Die meisten hier im Süden Brasiliens sind es nicht. Und diejenigen, die es sind, können, auch wenn sie gut informiert sind, deswegen doch nicht viel tun. Aber weshalb glauben wir (okay: nicht alle, doch viele) eigentlich ständig, irgendwas zu müssen? Eine hellsichtige Erklärung lieferte Oswald Spengler in „Der Untergang des Abendlandes“:
„Nicht was wir tun, was wir erstreben, was wir werten sollen, führt auf das Problem, sondern die Einsicht, dass diese Fragestellung ihrer Form nach bereits ein Symptom ausschliesslich des abendländischen Wertgefühls ist. Der westeuropäische Mensch steht hier unter dem Einfluss einer ungeheuren optischen Täuschung, jeder ohne Ausnahme. Alle fordern etwas von den andern. Ein "Du sollst" wird ausgesprochen in der Überzeugung, dass hier wirklich etwas in einheitlichem Sinne verändert, gestaltet, geordnet werden können und müsse. Der Glaube daran und an das Recht dazu ist unerschütterlich. Hier wird befohlen und Gehorsam verlangt. Das erst heisst uns Moral. Im Ethischen des Abendlandes ist alles Richtung, Machtanspruch, gewollte Wirkung in die Ferne. In diesem Punkt sind Luther und Nietzsche, Päpste und Darwinisten, Sozialisten und Jesuiten einander völlig gleich. Ihre Moral tritt mit dem Anspruch auf allgemeine und dauernde Gültigkeit auf. Das gehört zu den Notwendigkeiten faustischen Seins. Wer anders denkt, lehrt, will, ist sündhaft abtrünnig, ein Feind. Man bekämpft ihn ohne Gnade. Der Mensch soll. Der Staat soll. Die Gesellschaft soll. Diese Form der Moral ist uns selbstverständlich; sie repräsentiert uns den eigentlichen und einzigen Sinn der Moral. Aber das ist weder in Indien noch in China noch in der Antike so gewesen. Buddha gab ein freies Vorbild, Epikur erteilte einen guten Rat. Auch das sind Formen hoher - willensfreier - Moralen.“
Es liegt einige Zeit zurück, dass ich diesen Text zum ersten Mal las; die Einsichten, die er mir vermittelte, finde ich nach wie vor anregend, doch heutzutage genügen mir Einsichten nicht mehr, heutzutage (ich habe nämlich total GENUG von diesem dauernden Sollen und Müssen) benötige ich praktische Relevanz, und das meint: ich mag nicht mehr immer ‚müssen’ und ‚sollen’ und überhaupt: ich kann und darf so, wie ich mag. Wirklich? Ja, wirklich. Obwohl Spengler behauptet, wir seien alle Sklaven der Kultur, in die wir hineingeboren, sind wir eben doch nicht nur Opfer der Umstände (sicher, das auch, teilweise), wir können auch wählen.
Der Schweizer Schriftsteller Otto Steiger erzählte in „Ein Stück nur: Erinnerungen in Episoden“ wie er eines Tages beobachtete, er war bereits in fortgeschrittenen Jahren, wie eine Mutter mit ihrer Tochter, es regnete leicht, ein Haus verliess. Die Tochter war etwa acht, die Mutter Mitte vierzig. Die Mutter sagte: ‚Wir müssen rennen, sonst verpassen wir den Bus.’ ‚Ich mag aber nicht rennen’, erwiderte das Mädchen.
Möglich, dass Otto Steiger diese Geschichte anders erzählt hat als ich sie hier wiedergebe, doch dies ist, was ich erinnere – ja, ich verspüre eine Verpflichtung, nachzublättern, ob mich meine Erinnerung nicht täuscht, ob Otto Steiger diese Geschichte wirklich so erzählt hat, doch ich werde es nicht tun, ich mag mich nicht mehr von solchen Konditionierungen (man muss wörtlich zitieren, wenn man zitiert, sonst ist es kein Zitat) mein Denken und Fühlen und Verhalten bestimmen lassen.
A propos ‚mögen’ (die Geschichte geht auf meinen lieben, 2006 im Alter von 97 verstorbenen Münchner Freund Wamse zurück): Sagt die Mutter zum Kind, als sie die Wohnung verlässt: ‚Wenn ich nach Hause komm, will ich dein Zimmer aufgeräumt sehen.’ Als das Zimmer bei ihrer Rückkehr noch genau gleich ausschaut, stellt die Mutter die kleine Marie zur Rede. ‚Ich hab dir doch g’sagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Warum hast du es denn jetzt ned g’macht?’ ‚Ja, Mama, es tut mer ja selber so leid dass i ned megn hab’, erwiderte daraufhin die Kleine.
***
Was Kindern gelegentlich nachgesehen wird, wird bei Erwachsenen gnadenlos bekämpft:
„Sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel
zu spielen. Zeige ich ihnen, dass ich sie spielen sehe, dann
breche ich die Regeln, und sie werden mich bestrafen.
Ich muss ihr Spiel, nicht zu sehen, dass ich das Spiel sehe, spielen.“
schrieb Ronald Laing in „Knoten“
Ich habe GENUG von den Erwachsenen-Spielen. Und überhaupt weiss jeder, dass man wieder zum Kind werden muss, um das Leben zu begreifen – nein, nein, man muss gar nicht, MAN DARF.
Eines dieser Erwachsenen-Spiele ist das Fragen-Spiel, demgemäss es gute und schlechte, richtige und falsche Fragen geben soll. Als gute Frage gilt eine, auf die es keine, zumindest keine eindeutige Antwort gibt; um eine richtige Frage handelt es sich hingegen, wenn es darauf eine klare Antwort gibt. Und dann diese Pädagogen: Blöde Fragen gebe es nicht, sagen sie. Das ist Blödsinn: Blöde Fragen gibt es zuhauf. Man denke nur an Pädagogenfragen.
Richtig und falsch basieren auf willkürlichen Kriterien, auch Kontext (wer definiert den eigentlich?) genannt. Es versteht sich: Ohne diesen wären wir aufgeschmissen. Wer in Diskussionsrunden moniert, die andere (es kann auch ein Mann sein) habe, was er gesagt, aus dem Zusammenhang gerissen, versteht unter Zusammenhang immer seine eigene Definition davon.
Kane knew what he liked
(knowing what you liked was,
he felt, one of the most important
characteristics of a modern life well lived)
Nicola Barker: Darkmans (2007)
Wer heutzutage nicht weiss, was er will, ist am Arsch.
Durchwursteln ist keine Option, jedenfalls nicht in der Theorie. Heutzutage brauchen wir Businesspläne, Exposés und Dispositionen. Und wir müssen wissen, wie man die sogenannt richtigen Fragen stellt – sonst kann Google nicht helfen. Ein ziemlicher ‚circulus vitiosus’, nicht? Um die richtige Frage zu stellen, muss ich wissen, was ich will. Wenn ich nicht weiss, was ich will, weiss ich auch nicht, was und wie ich fragen soll.
Wer heutzutage nicht weiss, was er will, fällt aus dem System raus – und hat Glück gehabt, denn wie Shakespeare in ‚Hamlet’ dichtete: "Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt".
Und deshalb, gleich noch einmal: Ich habe GENUG davon, mir von andern einen Kontext aufzwingen zu lassen: Sich selber einen zu basteln ist schöner, beglückender und, ja klar, anstrengender, aber nur gelegentlich.